
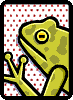

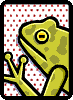
Integration und Gleichschaltung
Die Deutsche Gesellschaft für Psychotherapeutische Medizin (DGPM) berichtet in Berlin, sie habe „in beharrlicher Überzeugungsarbeit" erreicht, daß der aktuelle EBM-Entwurf 2000 ein eigenständiges Kapitel „Psychotherapeutische Medizin" umfasse. Der gesamte Bereich Psychotherapie würde sich danach aufgliedern in die Kapitel: „Psychiatrie und Psychotherapie", „Kinder- und Jugendlichenpsychiatrie und Psychotherapie", „Psychotherapeutische Medizin", Ärztliche Psychotherapie", „Psychologische Psychotherapie" und „Richtlinienpsychotherapie".
Danach haben sich anscheinend Gruppierungen durchgesetzt, gegen deren Berufspolitik sich laut öffentlichen Verlautbarungen am eindeutigsten der Berufsverband der Vertragspsychotherapeuten (bvvp) zu wehren bereit ist. Seine Politik für die Einheit der Psychotherapie kam zuletzt erneut in den „Konzeptionelle(n) Vorstellungen des bvvp zur Psychotherapie für die Gesundheitsstrukturreform 2000" vom 1. Mai und in einem Artikel der Ärzte Zeitung vom 18.Mai 1999 zum Ausdruck. Dabei gebührt dem bvvp Dank dafür, daß er seine Berufspolitik ähnlich wie die Vereinigung der Kassenpsychotherapeuten immer wieder öffentlich transparent macht, was man von anderen Verbänden aus dem Bereich der bisherigen Richtlinienpsychotherapeuten nicht sagen kann.
Es entbehrt nicht einer suggestiven und gewiß auch peinlichen Brisanz, wenn die DGPM ihren vorläufigen „Sieg" mit den Worten verkündet, daß mit dem aktuellen EBM-Entwurf alle Versuche, „die psychotherapeutische Versorgung gleichzuschalten", zum jetzigen Zeitpunkt gescheitert seien. Der Begriff „Gleichschaltung" erinnert leider an die diktatorische Gleichschaltung der Psychotherapie unter dem Hitlerregime; man sollte auf ihn verzichten. Die Chance, mit dem Integrationsmodell – noch ist es ja nur ein Modell, das leider auf dem Laufsteg bisher keine gute Figur macht – die erhoffte Gemeinsamkeit aller Psychotherapeuten herzustellen und mit ihr die Position gegenüber den großen ärztlichen Fachverbänden zu stärken, wird so vermutlich vertan.
Die Gemeinsamkeit wäre doch gegenüber den gesundheitspolitischen Plänen der Bundesregierung, die geeignet sind, den Machtzuwachs der Krankenkassen zu fördern, dringend nötig. Fürchtet und bekämpft man einerseits die angedachte Sektionierung der KVen durch die Politik von Gesundheitsministerium und Regierung, sektioniert man andererseits die Psychotherapie in verschiedene Fachgruppen, die über je eigene EBM-Kapitel ihre fachspezifischen Zapfsäulen erhalten sollen.
Nun haben die Gesellschafter der Psychotherapeutische Medizin natürlich ihre eigenen Sorgen mit ihren nächstverwandten Kolleginnen und Kollegen aus dem Fachgebiet „Psychiatrie und Psychotherapie", die sich, analog zu den Bestrebungen, den Hausarzt zum eigentlichen Erstzugangsarzt zu machen, gerne als Basisfacharzt für Psychotherapie sähen. So erklärt die DGPM, „interessierte Kreise" wollten ihr Fach über das seit 1.4.99 geltende Praxisbudget, das in einer „Nacht- und Nebelaktion" zustande kam, trockenlegen.
Dabei wäre es sicher angemessener, statt Grabenkämpfe in den eigenen Reihen zu führen, gemeinsam zu sondieren, wie der von vielen geschätzte fehlende Budgetbedarf von ca. 600 Millionen DM für die psychotherapeutische Versorgung 1999 auszugleichen sei. So hat z.B. der Präsident der Deutschen Röntgengesellschaft, Prof. Dr. med. Günter Kauffmann, am 11. Mai verlauten lassen, daß in Deutschland schätzungsweise auf die Hälfte der jährlich 100 Millionen Röntgenuntersuchungen verzichtet werden könnte, ohne die Qualität ärztlichen Handelns einzuschränken. Das bedeutete eine Kosteneinsparung von 800 Millionen DM. Da hätten wir schon die fehlenden 600 Millionen für die psychotherapeutische Versorgung.
Um hier die Honorarverteilungsmaßstäbe neu zu eichen, wäre man in den KVen, solange man ein ordentliches Eichamt fürchtet, auf demokratische Mehrheiten angewiesen, die den Maßstab angemessen bestimmen und ihn wirksam sein lassen gegenüber den 3 A´s, denen Prof. Kauffmann einen großen Teil der Honorarmisere anlastet: „Anordnen, Ausführen, Abrechnen!"
Die Psychologischen Psychotherapeuten, die ja seit 1.1.1999 in die KVen integriert werden können, wären dabei für die Herstellung von Stimmenmehrheiten ganz wichtig. Statt dessen rühmt die DGPM z.B. in Berlin „den bundesweit vorbildlichen Stand in der Gesetzesumsetzung" durch die Abteilung Qualitätssicherung der KV. Gemeint ist damit, daß hier unter fragwürdiger und nachträglicher Interpretation eindeutiger Gesetzesaussagen ein Zulassungssieb angewendet wird, das dem gesetzlich geregelten Entscheidungsrecht des Zulassungsausschusses vorgreift. Die Erinnerung an Zeiten der Großzügigkeit, mit der man im ärztlichen Bereich bei Übergangsregelungen Zusatztitel und Bereichsbezeichnungen verlieh, müßte doch wenigstens etwas betroffen machen gegenüber der Rigidität, mit der man jetzt approbierte Psychologische Psychotherapeuten unter das Joch der sog. „Qualitätssicherung" zwingt, mit dem man selbst im ärztlichen Bereich gerade erst damit begonnen hat.
FachkundenachweisEs ist richtig und vom Gesetz her notwendig, daß die Fachkunde in einem der bisherigen Richtlinienverfahren nachgewiesen wird, solange der Bundesausschuß keine weiteren psychotherapeutischen Verfahren anerkannt hat. „Rechtlich anfechtbar mit guten Aussichten bereits beim Widerspruchsverfahren vor dem Berufungsausschuß, spätestens aber vor dem Sozialgericht, wären Ablehnungen des Fachkundenachweises im Zulassungsverfahren, die mit einer fehlenden Übereinstimmung mit den Ausbildungsanforderungen im Rahmen der Richtlinienausbildung begründet werden (z.B. keine curricular erworbenen Theoriequalifikationen; zu geringe Frequenz der durchgeführten Supervisionen), da die Anforderungen an den übergangsdefinierten Fachkundenachweis nicht höher liegen dürfen als die berufsrechtlich für eine Approbation geforderten Qualifikationsnachweise (vgl. Behnsen 1998)." So, in einer gutachterlichen Äußerung des DPTV.
Das Problem wird ja hauptsächlich durch die „Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie" geschaffen, einem der drei durch den Bundesausschuß anerkannten Richtlinienverfahren, das noch immer in der curricularen Ausbildung zum Psychotherapeuten ein Stiefkind ist. Als ein, wie allgemein angenommen, von der Psychoanalyse abgeleitetes Verfahren, erfährt sie während der Ausbildung zum Psychoanalytiker nicht immer die Aufmerksamkeit, die sie verdient. Leider ist gerade auch für dieses Verfahren zutreffend, was Otto Kernberg, der derzeitige Präsident der Internationalen Psychoanalytischen Vereinigung, vor einiger Zeit auf einer Veranstaltung in Berlin im Blick auf die psychoanalytische Psychotherapie vortrug:
" Ich glaube, langsam wächst das Verstehen, daß die Psychotherapie nicht eine bastardisierte Psychoanalyse ist, sondern eine Technik, die genau so wichtig ist, ja viel wichtiger als die der klassischen analytischen Technik sein könnte. Die meisten Patienten sollten und könnten mit psychoanalytischer Psychotherapie und nicht Psychoanalyse selbst behandelt werden. Die Psychoanalytiker müssen lernen, eine spezifische Theorie und Technik der Psychotherapie zu entwickeln, statt eine chaotische Suppe von analytischen Techniken zusammenzumischen, wenn sie Psychotherapie machen."
Die „Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie" ist ein Behandlungsverfahren, das einmal den Ärzten mit der arrogant oft sog. „Kleiner Zusatztitel" genannten Bereichsbezeichnung „Psychotherapie" als Abrechnungsmöglichkeit in der GKV zugebilligt wurde. Sie wurde Abrechnungsziffer für die „Fachpsychologen in der Medizin" aus der ehemaligen DDR. Sie umfaßt, wie Faber-Haarstrick in ihrem Kommentar zu den Psychotherapierichtlinien 1989 formulierten, Therapieformen, die aktuell wirksame neurotische Konflikte behandeln und zwar mit Begrenzung des Behandlungsziels, durch ein konfliktzentriertes Vorgehen und durch Einschränkung regressiver Tendenzen. Heigl-Evers und Heigl heben in ihrem Lehrbuch der Psychotherapie hervor, daß hier eben verschiedene Formen von Psychotherapie einbezogen werden können, wenn sie die eingrenzenden Modalitäten dieser Methodenbestimmung durch die Richtlinien berücksichtigen.
Die Forderung des Fachkundenachweises gegenüber den KVen zwang viele Kolleginnen und Kollegen aus dem sog. „Kostenerstattungslager" in nachträgliche Supervisionen bei von der KBV anerkannten Supervisoren. Der Gesetzgeber konnte bei den Übergangsregelungen nicht gemeint haben, daß diese Kolleginnen und Kollegen ihre Fälle von Behandlungsbeginn an rite supervidieren ließen. Sie hätten dann ja ihre Ausbildung an anerkannten Instituten absolviert. Die Aufgabe der Supervisoren war und ist also, festzustellen, inwieweit diese Kolleginnen und Kollegen entsprechend der Richtliniendefinition tiefenpsychologisch fundiert behandelt haben; wobei sich häufig zeigte, daß sie Formen von Psychotherapie beherrschten, mit denen sie eindeutiger tiefenpsychologisch arbeiten konnten als psychoanalytische Ausbildungskandidaten, denen es am Anfang häufig schwer fiel, zwischen den unterschiedlichen „Instrumenten" der psychoanalytischen und tiefenpsychologischen Behandlung zu wechseln.
Die Maßgabe der Vorprüfungseinrichtungen der KVen im Sinne der Qualitätssicherung, in die sie dann gelegentlich auch die Beurteilungen der Supervisoren einbezogen haben sollen, dürfte vor lauter urdeutschen Sicherungsbedürfnissen nicht das reale psychotherapeutische Leben vernachlässigen, wie es vom Gesetzgeber in den Übergangsregelungen des Psychotherapeutengesetzes geschützt worden ist.
Das ZeitfensterGanz selbstverständlich wird in der DGPM-Verlautbarung auch dem sog. "Zeitfenster" zugestimmt, aus dem nun anscheinend viele Zulassungsantragsteller geworfen werden sollen. Das heißt sie werden nicht bedarfsunabhängig zugelassen, wenn sie nicht eine Behandlungsstundenzahl von 250 Stunden in den Jahren 1994-1997 bei gesetzlich Krankenversicherten nachweisen. Hier wird das Psychotherapeutengesetz frappant umgedeutet, denn dort heißt es eindeutig: Der approbierte psychologische Psychotherapeut muß "in der Zeit vom 25. Juni 1994 bis zum 24. Juni 1997 an der ambulanten psychotherapeutischen Versorgung der Versicherten der gesetzlichen Krankenversicherung teilgenommen haben"; von einer Stundenzahl ist hier nicht die Rede. Eine Verweigerung der Zulassung ist also nur möglich, wenn Antragsteller in diesem Zeitraum an dieser Versorgung nicht teilgenommen haben. Dieses müßte der Zulassungsausschuß belegen. Die nachträgliche Einführung der 250-Stundenregel führte auch umgehend zu Konfusionen. So teilte der Zulassungsausschuß Berlin Psychologischen Psychotherapeuten, die in diesem Zeitraum zum Delegationsverfahren zugelassen waren, bereits am 6.10.1998 offiziell mit, "daß (sie) die Grundvoraussetzungen für eine bedarfsunabhängige Zulassung erfülle(n), da (sie) den Fachkundenachweis erfüllen und, wie in § 95 Abs. 10Satz 3 PsychThG gefordert, in der Zeit vom 24.6.94 – 24.6.97 an der ambulanten psychotherapeutischen Versorgung der Versicherten der Gesetzlichen Krankenversicherung teilgenommen haben". Weiter heißt es in diesem Schreiben: "Daher brauchen Sie dem Zulassungsausschuß weder Fachkunde nachzuweisen noch die Abrechnungsgenehmigung erneut zu beantragen." Ebenso hieß es in den Hinweisen zum Antrag auf Zulassung/Ermächtigung zur vertragsärztlichen Versorgung nach den Übergangsbestimmungen (§ 95 Abs. 10/11 SGB V) unter A: Die Anlage (blaues Formular) – Nachweis der Teilnahme an der Versorgung vom 25.6.94 – 24.6.97: "Dieser Nachweis entfällt für alle Psychotherapeuten, die in diesem Zeitraum am Delegationsverfahren bei der KV Berlin teilgenommen haben".
Der Zulassungsausschuß Berlin hat also das PTG zunächst richtig verstanden. Dann schien er durch die Abteilung "Qualitätssicherung" und die Einflüsse der KBV, maßgeblicher KV-Persönlichkeiten und Verbandsvertreter irritiert worden zu sein, womit die Frage nach seiner Unabhängigkeit zu stellen erlaubt ist. Denn nachträglich wurde nun das sog. "Schirmer"-Papier der KBV als Interpretationshilfe herangezogen. Dessen Hauptthese ist: Das PTG sei hinsichtlich seiner Formulierungen zum "Zeitfenster" interpretationsbedürftig. Als Interpretationshilfe zog er die von ihm sogenannten "Gesetzgebungsmotive" heran.
Über die Problematik dieser "Motivforschung" haben wir an schon früher berichtet und verweisen darauf.
In mehreren juristischen Gutachten wird deshalb diese Handhabung des Zeitfensters als rechtlich fragwürdig und ermessensfehlerhaft beurteilt.
Darüber hinaus muß aber auch an das Grundgesetz erinnert werden, dessen 50-jähriger Bestand in diesen Tagen gefeiert und gewürdigt wird. Nach dem Rechtsstaatsprinzip des Grundgesetzes ist der Gesetzgeber nur unter engen Voraussetzungen berechtigt, Rechtsfolgen für einen vor Verkündung der Norm liegenden Zeitpunkt eintreten zu lassen. Die vom Bundesverfassungsgericht entwickelten Grundsätze zur Zulässigkeit echter Rückwirkung gelten auch für untergesetzliche Rechtsnormen. Die Voraussetzungen, unter denen sich normative Regelungen nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts echte Rückwirkung beilegen dürfen, sind hinsichtlich der hier zu beurteilenden Regelungen nicht erfüllt. Selbst ein Gesetz kann nicht rückwirkend greifen, wenn der Betroffene damit nicht rechnen und deshalb seine Dispositionen darauf nicht einstellen konnte.